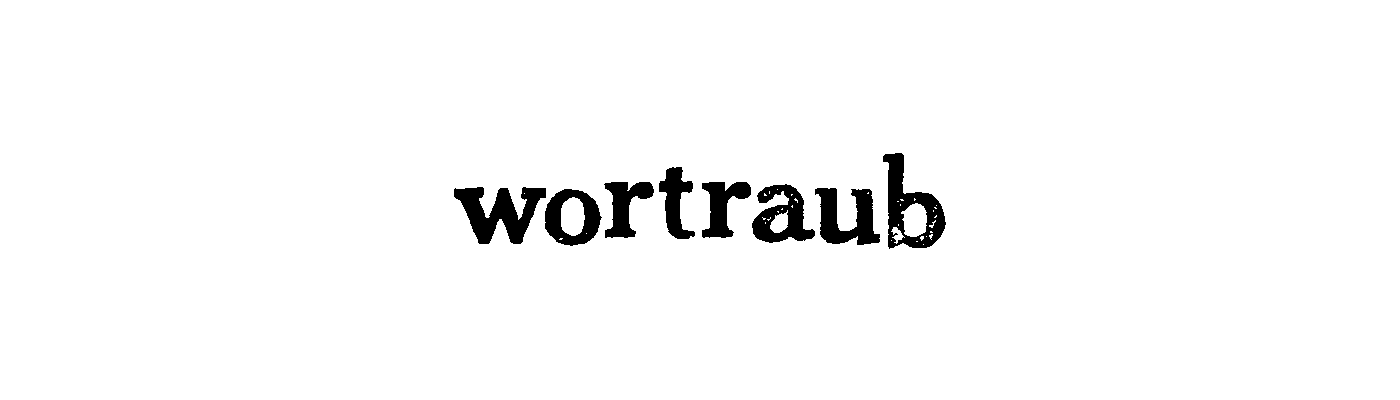Theorie und Praxis: Warum auch Computerspiele ein theoretisches Fundament brauchen
Noch vor einigen Jahren konstatierte der Computerspiel-Pionier Warren Robinett (bekannt für Adventure auf der Atari 2600-Konsole) seinem Arbeitsfeld eine Extrem-position in Sachen intellektueller Wertschätzung. Er siedelte Computerspiele zusammen mit Pornos und Comics auf der niedersten Stufe der akademischen Interessensgebiete an und bezeichnete sie als das „Ungeziefer der Kunstwelt“.
Dabei hatte schon Anfang des 20. Jahrhunderts der holländische Kulturwissenschaftler und Kulturphilosoph Johan Huizinga eine Studie vorgelegt, nach der das Spiel ein wesentlicher Bestandteil aller menschlicher Kulturen sei. Der Mensch und seine Errungenschaften seien geprägt vom Spiel. Der von Huizinga bereits 1938 proklamierte Homo Ludens sei notwendig gewesen, um Kunst, Philosophie, Dichtung, Recht und Wissenschaft überhaupt erst entstehen zu lassen. Dass in Deutschland aber trotz dieser Erkenntnisse bisher kaum eine groß angelegte Forschungsarbeit zur Theorie des Spielens, insbesondere des Computerspielens stattgefunden hat erklärt sich wenn überhaupt dann nur durch die von Robinett beklagte Negativbewertung des Gegenstandes.
„Computerspiele sind ein enorm wichtiger Teil der Populärkultur und nehmen mittlerweile den größten Teil der Unterhaltungsindustrie ein“, sagt Prof. Dr. Frans Mäyrä von der University of Tampere in Finnland, „und eine ernstzunehmende Kultur- oder Medienwissenschaft muss dieser Entwicklung Rechnung tragen.“ Mäyrä ist Leiter des Game Research Lab, an dem schon seit 1999 zu den theoretischen Fundamenten von Computerspielen geforscht wird. Unter seiner Leitung forschen Wissenschaftler und Studenten an der Konstruktion von Spielwelten, den psychologischen Beschaffenheiten des Spiels und den sozialen Räume, die Spiele erschaffen. „Ein wichtiger Forschungsbereich für uns ist die Durchdringung unseres sozialen Raumes mit Computerspielen“, sagt Mäyrä und bezieht sich auf das, was die Forscher „Gamification“ nennen. Hier wird erforscht, wie Spielmechanik, Belohnungsprinzipien und Spielelemente (z.B. Fortschrittsbalken) in das reale Leben und dessen Gestaltung Einzug halten.
Dass diese Forschung keineswegs nur im Elfenbeinturm stattfindet sondern auch im realen Leben Wirkung entfaltet, beweist auch die Brunel University in der Nähe von London, die sogar einen Doktorandenprogramm in „Games Theory“ anbietet. Prof. Dr. Tanya Krzywinska bezeichnet die dort entstehende Forschung als „Traumehe von Theorie und Praxis“ und glaubt fest an die Rückwirkung auf die Gamesbranche: „Unsere Absolventen erlangen nicht nur praktische Fähigkeiten ein Spiel zu designen, sondern werden auch intensiv in den theoretischen Grundlagen des Spiels geschult. Die Spielerfahrung, das soziale Umfeld, der strukturelle Aufbau von Kulturgüten im allgemeinen – all das hilft ihnen später dabei, bessere und intelligentere Spiele zu entwickeln.“
So fördert die Universität auch den Austausch von Wissenschaft und Branche, in dem sie Foren gestaltet und Symposien organisiert. „Hier findet ein Austausch über die formellen, die ästhetischen und die kulturphilosophischen Aspekte von Computerspielen statt und dabei geht es auch immer wieder um den kulturellen Wert von Spielen. Unsere Diskussionen tragen dazu bei, ein Bewusstsein für die Bedeutung von Spielen zu schaffen“, erklärt Krzywinska, „und das ist auch der Industrie klar, die unsere Arbeit unterstützt und davon profitiert.“
Die in Deutschland bestehenden Hochschulangebote (siehe IGM 05/2012) stützen ihre Ausbildung zwar auch auf theoretische Anteile, doch der Grad der Reflektion (z.B. die Möglichkeit Dissertationen zu diesen Themen zu erlangen) und die Einbindung in bestehende Disziplinen der Kulturwissenschaft, Soziologie oder Philosophie, wie ihn andere europäische und amerikanische Universitäten bieten, vermissen wir in Deutschland schmerzhaft. Einige erste Initiativen, wie das 2008 an der Universität Potsdam gegründete Zentrum für Computerspielforschung (DiGaReC) weisen zwar den Weg, aber noch ist die Forschungslandschaft in Deutschland eher unterbesetzt. Ein Manko, das man immer dann deutlich spürt, wenn Politiker und Boulevard sich wieder einmal an medialer Hexenverbrennung ergötzen, wie unlängst im Falle des Gewinners des deutschen Computerspielpreises „Crysis 2“. Eine theoretisch fundierte und kulturwissenschaftlich orientierte Forschung könnte hier helfen, um plumpe Stigmatisierungen („Killerspiele“) zu vermeiden und selbst Shooter als kulturelle Artefakte von Wert anzuerkennen.
Ursprünglich erschienen in IGM 07/2012.