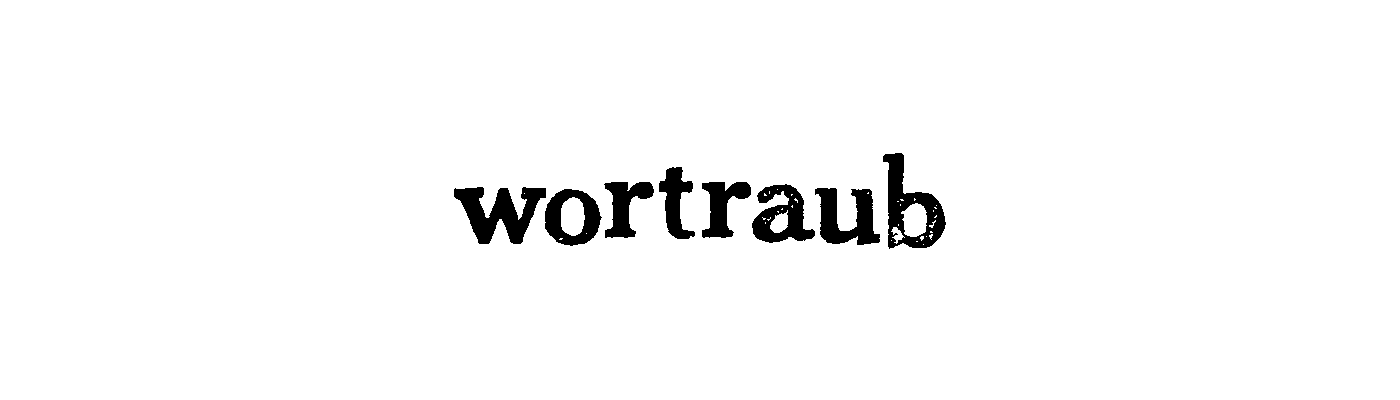Fear And Loathing in Vancouver
Die kanadische Rockszene boomt, und das nicht nur dank Billy Talent und Danko Jones aus Toronto. Auch die Westküste mit ihrer kosmopolitischen Metropole Vancouver bietet dem Musikfan eine Menge, wie zum Beispiel die junge, frische Band The Vincent Black Shadow. Mit ihrem nicht in eine gängige Genre-Schublade zu packenden Stilmix erobern sie derzeit den US-Markt und machen sich jetzt auch in Deutschland auf, um durch die Musikwelt zu wirbeln.
The Vincent Black Shadow lieben das Neue, das Unbekannte und das Unvorhersehbare. So verwundert es dann auch nicht, als die drei ungleichen Brüder, mit denen eigentlich das Interview laufen sollte, sich erstmal über das Malzbier amüsieren, das auf dem Tisch steht, um dann gleich jeder eines zur Probe zu bestellen. „Mann, das schmeckt ja gar nicht so süß wie ich dachte,“ sagt Rob Kirkham, Gitarrist der Band, und beweist, dass Werbefilm-Klischees eben doch war sind. Und auch sein Bruder Chris, Bassist der Band, ist einigermaßen angetan von dem Getränk. Nur Bruder Nummer Drei, Anthony, seines Zeichens Drummer, ist nicht ganz so begeistert: „Naja, habe auch schon mal was besseres getrunken. Bier ohne Alkohol ist doch langweilig.“ Um den Reigen der Band komplett zu machen, fehlt eigentlich nur noch Cassandra Ford, die Sängerin, die aber erst am Abend zum Konzert zu der Truppe dazu stoßen wird. Und beim Anblick der drei Brüder fällt schon auf, warum man sich musikalisch so schwer damit tut, die Band in eine Genre einzuordnen, denn Rob sitzt mit seinen wuscheligen blonden Haaren und dem lockeren T-Shirt da, als ob er eigentlich über das Surfen reden möchte, während Chris in Punkhose, Springerstiefeln und Armeejacke sowie dunklen gespikten Schopf wirkt, als kotze ihn der ganze Rummel eher an. Nur Tony hängt noch vom Vorabend durch, in Guns’N’Roses Bandana und Danzig-T-Shirt, die Verkörperung des 80er Jahre Metal. Wie kommen die drei da bloß in ein und derselben Band klar? „Naja, wir sind zwar alle unterschiedliche Typen und mögen ganz andere Musik, aber wir bringen genau das zusammen und daraus wird dann der Soundmix von TVBS“, erklärt Chris das Zusammenspiel. Rob ergänzt: „Chris ist der Punk, Tony der Metaller und ich steh halt auf die Melodien, egal ob nun von den Beach Boys oder von Faith No More.“
Man hört ihrem Debüt an, dass viele Einflüsse drin sind, neben einigen Punk oder Goth-Elementen vor allem aber alte Stile, wie etwa Swing, Rockabilly oder Ska, ein wenig sogar Chanson oder Musical. Alte Musik hat die Jungs also inspiriert, und so wildern sie vornehmlich in der Radio-Ära der 20er bis 50er Jahre. „Das liegt daran, dass Musik damals noch mit einem anderen Bewusstsein gehört wurde. Deswegen wirkt unsere Platte vielleicht ein wenig nostalgisch. Wir wollten dieses Bewusstsein zurückholen. Damals hat man sich noch hingesetzt und ganz aufmerksam dem Radio zugehört, das war die Unterhaltung. Man achtete auf die Musik, das Zusammenspiel der Instrumente und den Inhalt der Texte. Heute stehen die Leute im Club und unterhalten sich den ganzen Abend, die Musik dient nur noch als Soundtrack im Hintergrund“, gerät Chris ins Philosophieren. Rob stimmt dem zu und ergänzt etwas platter: „Heutzutage ist Musik wie ein Essen bei McDonald: du kannst dort Nahrung bekommen, aber satt bist du höchstens zehn Minuten lang.“ Tonys Einwurf dazu ist nur ein lakonisches „Und dann kotzt du!“ Ok, Pop ist also nicht ihr Ding, doch wie würden sie dann ihrer Musik selber beschreiben?
„Kennst du Hunter S. Thompson? weißt du was Gonzo-Journalismus ist? Das machen wir, nur eben mit Musik,“ erklärt Rob das musikalische Konstrukt, das The Vincent Black Shadow darstellt. Somit erklärt sich dann auch der Name der Band, der sich auf ein Motorrad bezieht, dass Thompson in einem seiner Bücher beschreibt. „Thompson schrieb wie er wollte und was er wollte. Er hatte keinen festgelegten Stil und keine Struktur. Wenn du mich fragst, was wir machen, dann sag ich nur: Gonzo!“ Rob ist geradezu begeistert von seiner Adaption des Schreibstils von Thompson. Doch der Autor von „Fear And Loathing In Las Vegas“ schrieb seine Gonzo-Werke aus Ermangelung an Recherche und unter einer Menge Drogeneinfluss, gebar aus der Not einer schlechten Arbeitsmoral die Tugend eines neuen, freien journalistischen Stils. „Mann, genau das ist es. Wir sind auch nicht in theoretischen Grundlagen trainiert, keiner von uns hat eine Musikschule besucht,“ verteidigt Rob seinen Vergleich. Und Chris, der eher skeptisch das Wort „Gonzo“ umgeht, ergänzt: „Sieh es doch mal so, wir spielen ja noch nicht einmal die Instrumente, die wir gewohnt sind. Bisher war ich immer der Gitarrist und Rob der Bassist. Nur in dieser Band haben wir getauscht, was sich dann auch auf unsere Herangehensweise ausgewirkt hat.“ Rob fällt ihm ins Wort: „Ja, ich denke nicht in Form von angeberischen Soli oder Riffs, ich spiele viel Rhythmus. Das meine ich ja, wir machen das halt, wie wir Bock haben. Hauptsache ist doch das ein toller Song dabei rauskommt und nicht, dass es technisch perfekt auf dem Notenpapier steht.“ Zugegeben, ihr theoretischer Ansatz ist eher kreativ, nicht so sehr auf musikalischer Theorie basierend, aber sie sind auch ganz bestimmt keine Dilettanten. Das Album ist thematisch sehr wohl dicht und nicht etwa ein wirrer Gedankenteppich, wie ihn Thompson produziert hat. Auf dem soliden Fundament des Rock bauen sie ihre Songs auf, die dann mit Hilfe der besten musikalischen Einflüsse der letzten 80 Jahre Musikgeschichte eine Collage erschaffen, die man in dieser Form noch nicht gehört hat.
Um so viel musikalischer Vielfalt eine einheitliche Note zu verleihen, bedarf es einer großartigen Stimme. Die kam in Form der kleinen Halbasiatin Cassandra Ford in die Band, die mit ihrer beeindruckenden Vokalperformance die Songs zu einem Erlebnis macht. Trotz ihrer körperlichen Zierlichkeit vermag Cassie nämlich ein wahres Stimmwunder zu vollbringen und den schrägen Musikcollagen ihrer Kollegen eine geniale, warme Note zu verleihen, die TVBS zu etwas ganz Eigenem macht und das heterogene Gefüge verbindet. Und wie sieht sie ihrer Rolle in dem von drei Brüdern geprägten Bandgefüge? „Ich sehe mich als Künstlerin. Ich fühle mich mit der Rolle der Frontfrau nicht immer sehr wohl, weil die Leute so viele Erwartungen daran haben. Aber ich mache auch das gesamte Artwork, bin ein Digital Artist und arbeite viel auf der visuellen Ebene,“ sagt Cass im Gespräch nach dem Konzert. Und tatsächlich reagiert sie auf Komplimente von Fans zu ihrer Performance eher verschüchtert, weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Dabei wirkt sie auf der Bühne fast schon zu sicher, singt ganz selbstvergessen ihre Songs und scheint dabei gar nicht zu merken, wie sie dem (männlichen) Publikum den Kopf verdreht. Sie ist es auch, die als Kreative der Band, den Texten eine Form verleiht. Und die sind schräg, handeln von der düsteren Seite des Lebens und erinnern in ihrer Ästhetik ein Bisschen an Emily the Strange. „Ich mag es nicht, wenn die Leute meine Texte zu wörtlich nehmen. Oder aber meine Sicht nicht verstehen. Es passiert mir ständig, dass ich darauf angesprochen werde, das „Don’t Go Softly“ ja so ein schöner Liebessong sei. Dabei geht es um den Akt, tatsächlich ein Herz zu brechen, es quasi aufzuschneiden.“ Cassie schaut dabei so niedlich und zart aus, dass man kaum glauben mag, dass eine derartig makabre Aussage dahinterstecken soll. Aber das ist dann auch wieder so unvorhersehbar, dass es irgendwie passt und dieser Band gut zu Gesicht steht.
Der Artikel ist erschienen im Access! All Areas Ausgabe 01/07.